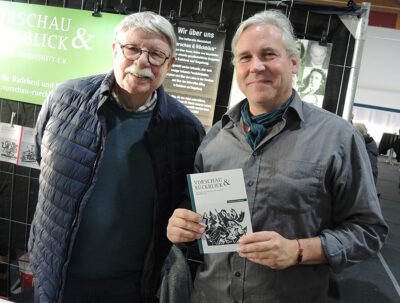25 Jahre Förderkreis der Stadtgalerie Radebeul
Es war schon beeindruckend, zur Jubiläumsveranstaltung am 25. Oktober 2024 einmal die wunderbaren Bilder von Gussy Hippold, Paul Wilhelm, Heinz Drache, Kurt Thoenes, Günter Schmitz, Peter Graf, Eckhard Kempin und Friedrich Porsdorf, welche vom Förderkreis der Stadtgalerie für die Städtische Kunstsammlung angekauft bzw. bezuschusst wurden, in einem Ausstellungsraum versammelt zu sehen.

v.l.n.r.: Alexander Lange, Margitta Czura, Karin Baum, Gudrun Wittig, Dirk Kloppisch, Hans-Jochen Müller
Foto: N. Millauer
Das offizielle Programm des Festaktes war straff gebaut. Acht Redner reflektierten in jeweils drei Minuten ihre Beziehung zum Förderkreis aus individueller Sicht. Der Saxophonist Hartmut Dorschner hatte sich der Herausforderung gestellt, zwischen all den kontroversen Geistesblitzen eine sinnstiftende Verbindung zu schaffen. Unter den über 60 Gästen befanden sich Kunstinteressierte, Künstler, vier Stadträte und der Oberbürgermeister, welcher auch eine, der acht kurzen Reden hielt.
Es war ein heiterer Abend, der keinen Anspruch auf Perfektion erhob. Dort, wo sich die Mitglieder des Förderkreises mit Festrednern, Ehrengästen und dem Musiker zum Gruppenbild für die Vereinschronik hätten formieren können, blieb ein weißer Fleck. Die Feier war sooo schööön, dass man erst wieder daran dachte, als sich alle auf den Heimweg begeben hatten. Auch in der Tagespresse ist bis jetzt noch nichts erschienen, weder zum langjährigen Wirken noch zum runden Jubiläum des rührigen Vereins. Wie gut also, dass es „Vorschau & Rückblick“ gibt. Und auch der Fotograf Norbert Millauer half die dokumentarische Leerstelle zu füllen.

Bei Karen Graf im Atelier
Nun, lässt es sich nicht leugnen, „25 Jahre“, das ist schon eine sehr lange Zeit! Doch manche Geschichten liegen noch viel weiter zurück. War es nun Zufall oder vorausschauende Absicht, dass mir meine Klassenkameradin Gudrun Nebel vor 56 Jahren zu meinem 15. Geburtstag einen Katalog des Radebeuler Malers Karl Kröner schenkte? Gudrun Nebel heißt heute Gudrun Wittig und ist die Vorsitzende des Fördekreises der Stadtgalerie. Ich selbst schrieb viele Jahre später meine Diplomarbeit über Malerei und Grafik in Radebeul und leitete von 1984 bis 2019 die Radebeuler Stadtgalerie. Alles hängt eben immer wieder irgendwie mit allem zusammen.

Im Depot der Städtischen Kunstsammlung Freital
Diese nachhaltige Schenkung also erfolgte in jener Zeit, als sich die Schulen „Allgemeinbildende Polytechnische Oberschule“ nannten und sehr viele Läden die Namen von Leuten trugen. So wie die legendäre Buchhandlung Sauermann, welche Gottfried Sauermann von seiner Mutter, der Witwe von Heinrich Sauermann übernommen hatte. Dort arbeitete auch Manfred Artur Fellisch als Buchhändler und Antiquar, der die Bücher nicht einfach nur verkaufte, sondern zelebrierte. Die älteren Radebeuler werden sich daran vielleicht noch erinnern können. Dass sich sowohl Gottfried Sauermann als auch Manfred Artur Fellisch, der dann schon eine leitende Stellung im Dresdner Kulturamt innehatte, überzeugen ließen, an der Gründung eines Fördervereins für die Stadtgalerie mitzuwirken, war großes Glück.

In der Alten Molkerei, Plastik von Manuel Frolik
Zu den Gründungsmitgliedern des Förderkreises gehörte auch Lars Hahn. Obwohl er als Elektriker arbeitete, hatte er ein gutes Gespür für Kunst und moderierte bereits die Versteigerungen in der Kleinen Galerie in Radebeul Ost. Ein Foto aus den 1980er Jahren, das den jugendlichen Auktionator Lars Hahn in Aktion zeigt, stammt von dem Amateurfotografen Hans Fischer, so wie auch jenes Foto, welches damals zur Versteigerung angeboten wurde. Das symbolbeladene Bildmotiv mit der weißen Taube auf einer historischen Kanone ist aktueller denn je.

Die Auktionatoren Lars Hahn und Manfred Artur Fellisch
Nicht zuletzt auf Drängen der Radebeuler Künstlerschaft wurde die „Kleine Galerie Radebeul“ am 16. Dezember1982 in einem ehemaligen Tapetenladen auf der Ernst-Thälmann-Straße 20 (heute Hauptstraße) eröffnet. Nach der Kündigung des Mietvertrages per 1. Juli 1995 setzte die Galerie ihre Ausstellungstätigkeit ohne Unterbrechung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern fort. Nach zweijährigem Exil erfolgte die Wiedereröffnung der Stadtgalerie am neuen Ort, im Dreiseithof Altkötzschenbroda 21.

Auktion »Kunst & Kuriositäten«
Personelle Unterstützung erfuhr die Galerie durch den im Jahr 1996 gegründeten Radebeuler Kunstverein. Dessen Vorsitzende wiederum war Ingeborg Bielmeier, die schon vor 1990 im Galeriebeirat der „Kleinen Galerie Radebeul“ mitgearbeitet hatte. Dass sich nun ein weiterer Verein speziell zur Unterstützung der Städtischen Galerie gründen sollte, löste zunächst etwas Unverständnis aus. Manfred Artur Fellisch hatte die Notwendigkeit für die Gründung eines Förderkreises sehr treffend formuliert: „…dem städtischen Kunstleben wollen wir einen kleinen Zweig hinzufügen. Für unsere Stadtgalerie möge es ein starker Ast werden, an dem sie sich in schlechten Zeiten halten und in guten Zeiten freuen kann.“
Nach dem ersten Treffen zur Gründung des Fördervereins am 26. Mai 1999 in der Stadtgalerie, folgte am 25. Oktober 1999 die konstituierende Gründungsversammlung und im Jahr 2000 die Eintragung ins Vereinsregister unter der präzisen Bezeichnung „Förderkreis der Stadtgalerie Radebeul e.V.“. Den Vereinsvorsitz hatte Manfred Artur Fellisch inne. Im Jahr 2007 übernahm Gudrun Wittig diese Funktion.
Aus Anlass des runden Jubiläums wurde auch eine chronologische Bild- und Textdokumentation zusammengestellt, welche veranschaulicht, was in den letzten 25 Jahren vom Förderkreis geleistet wurde. Vieles hätten die Mitarbeiter der Stadtgalerie ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer gar nicht bewältigen können. Seien es Veranstaltungen wie der traditionsreiche „Radebeuler Grafikmarkt“, das originelle „Radebeuler Künstlerfest“ oder die in Coronazeiten konzipierte Veranstaltungsreihe „Kunst geht in Gärten“. Die Auktion „Kunst & Kuriositäten“, welche in Eigenregie des Förderkreises erfolgt, ist wiederum ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man auch auf bewährte Projekte zurückgreifen kann, um diese dann mit neuen Ideen weiterzuentwickeln. Auch zur zuverlässigen Gewährleistung der Öffnungszeiten leisten die Mitglieder des Förderkreises einen nicht zu unterschätzenden Beitrag.
Wenn ein Verein so lange existiert, ist das natürlich auch mit Höhen und Tiefen verbunden. Unmerklich setzt die Überalterung ein und frische Ideen werden zu Mangelware. Der Beitritt von sieben neuen Mitgliedern aus dem ehemaligen Radebeuler Kunstverein, der sich 2018 aufgelöst hatte, trug zur Stabilisierung bei, war aber noch längst nicht die Lösung des Problems. Mit der Feststellung „Wenn wir so weitermachen, wird es den Verein schon bald nicht mehr geben“, hielt man sich jedoch nicht allzu lange auf. Der Vorstand wurde personell verstärkt und die Mitglieder brachten sich fortan aktiver in die Vereinsarbeit ein. Es wurden Arbeitsgruppen gebildet und Verantwortliche benannt u. a. für die Bereiche „Allgemeine Vereinsorganisation“, „Fachspezifik Kunst“, „Künstlercafé“, „Kunst & Kuriositäten“, „Druckerzeugnisse“, „Homepage“…
Alle Aktivitäten des Förderkreises sind im unmittelbaren Sinne auf den Erhalt der Stadtgalerie und der Städtischen Kunstsammlung ausgerichtet. Entscheidend ist, dass die Ehrenamtler des Förderkreises und die Hauptamtler der Stadtgalerie miteinander und nicht gegeneinander arbeiten, dass die kontinuierliche und offene Kommunikation
reibungslos funktioniert.
Ein ausführlicher Beitrag über die Geschichte und das Wirken des Förderkreises war bereits 2017 in „Vorschau & Rückblick“ erschienen und steht im Netz. Ansonsten hielt sich der Verein über all die Jahre recht bescheiden im Hintergrund. Aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums wurde erstmals ein Flyer gedruckt. Die Homepage ist allerdings noch immer in Arbeit. Aber was lange währt, wird hoffentlich besonders gut!
Zum Radebeuler Grafikmarkt war der Verein mit seiner Pop-Up-Jubiläumsausstellung präsent und hat sehr anschaulich gezeigt, dass die Vereinsmitglieder nicht nur Kuchen backen können.
Und wie steht es nun um das vielzitierte Ehrenamt? Thomas Gerlach, „Meister der festlichen Rede“, brachte es zur Jubiläumsveranstaltung mit einem Vergleich sehr schön auf den Punkt: „Heinzelmännchen, wir erinnern uns, sind geheimnisvolle Wesen, die wie selbstverständlich zupacken und tun, was getan werden muss, ohne selbst in Erscheinung zu treten. Im modernen Sprachgebrauch werden sie meist Ehrenamtler genannt.“ Und um die Ambivalenz seiner Worte zu unterstreichen, endeten seine Ausführungen abrupt mit der mahnenden Warnung „Wer der Stadt Bestes sucht, hüte sich vor Erbsen auf der Treppe…“
Die heutigen „Heinzelmännchen“ sind stark gefordert. Sie stehen zum Teil noch voll im Berufsleben und müssen sich die ihnen verbleibende Zeit gut einteilen. Aber auch die sogenannten Ruheständler sind oftmals multiaktiv und alles andere als verträumt. Was die achtzehn agilen Vereinsmitglieder verbindet, ist die Liebe zur Kunst und zu Radebeul.
Die Exkursionen in Museen und Sammlungen bieten Anregung und weiten den Blick. Vor allem die unmittelbaren Kontakte zu den Künstlern in ihren Ateliers, dort wo die Kunst entsteht, befördern das Verständnis auch für die Situation der freischaffenden Künstler enorm. Besucht wurden u.a. Annerose und Fritz Peter Schulze, Irene Wieland, Sophie Cau, Karen und Peter Graf, Gabriele und Detlef Reinemer sowie die junge Künstlergemeinschaft in der „Alten Molkerei“, kurz bevor diese ihre Radebeuler Atelierräume verlassen musste.
Im kommenden Jahr wird es wieder die beliebte Auktion „Kunst & Kuriositäten“ geben und eine Exkursion ins Depot des Meißner Stadtmuseums steht auch schon auf dem Plan. Die Umsetzung der Städtischen Kunstsammlung bis Ende 2025 an einen geeigneten Depotstandort bildet die größte Herausforderung. Viele mitdenkende Köpfe und helfende Hände sind hierfür erforderlich. Die Mitglieder des Förderkreises beabsichtigen den Vorgang sowohl ideell als auch praktisch zu begleiten. Auch die Redaktion von “Vorschau & Rückblick“ wird fortlaufend darüber berichten.
Explizit gefragt sind dabei allerdings Politik und Verwaltung. Ob den Entscheidungsträgern die Förderung von Kunst, Kultur und Ehrenamt tatsächlich wichtig ist, das wird sich zeigen. Wie heiß es doch: „An ihren Taten sollt ihr sie erkennen!“. Die Mitglieder des Förderkreises sind zwar so hilfsbereit wie die „Heinzelmännchen“, wollen aber von der Stadtgesellschaft ernst- und wahrgenommen werden. Das Streuen von Erbsen sollte man deshalb tunlichst unterlassen!
Karin (Gerhardt) Baum
Flyer, Aufnahmeanträge und Satzungen des Förderkreises der Stadtgalerie sind in der Galerie erhältlich. Der direkte Kontakt zum Förderkreis ist über die Vereinsvorsitzende Gudrun Wittig möglich unter: 0351-8307555, foerderkreis.radebeul@gmx.de
Fotos: K. (Gerhardt) Baum, S. Preißler